Die Werbeagentur Müller&Glanz hat einen hervorragenden Ruf in der Branche. Marie arbeitet seit sechs Jahren als Werberin in der Firma und wird als mögliche Partnerin in Betracht gezogen. Ihre Präsentationen werden immer von allen Beteiligten gerühmt – ihre Kampagnen sind hervorragend und die Präsentationen transportieren ein Erlebnis. Dafür investiert Marie unzählige Abend- und Wochenendstunden. In der Nacht vor der Präsentation schläft sie jeweils kaum, ihre Gedanken kreisen. Sie hat Angst, dass auffliegt, dass sie alles falsch gemacht hat und die Kampagne die Erwartungen nicht erfüllt.
Das Impostor- oder Hochstapler-Syndrom
Marie ist nicht alleine – Zeitungen berichten vom Hochstapler-Syndrom und US-Studien (beispielsweise Rosenthal et al., Shreffler et al.) zufolge leiden neun von zehn Medizinstudierende am Impostor-Syndrom. Grosse Selbstzweifel, welche unabhängig von der tatsächlichen Leistung sind, haben längst nicht nur Marie und Studierende, sondern es kann uns alle treffen.
Wenn dieses Gefühl von „Irgendwann fliege ich auf“ überwiegt, spricht man in der Psychologie vom Impostor-Syndrom. Oft tritt es im Rahmen der Arbeitswelt auf, kann jedoch alle Lebensbereiche betreffen.
Marie’s nächste Präsentation ist erneut ein Erfolg. Die Kolleginnen feiern sie und es wird spekuliert, ob Marie erneut den Preis der Werberin des Jahres bekommt, wie bereits die vergangenen drei Jahre. Marie tut ihren Erfolg jedoch als Glück ab. Da helfen weder die letzten drei Auszeichnungen noch die Wertschätzung und Bewunderung ihrer Kolleginnen und Kollegen. Stattdessen kann sie sich noch gut an die eine Kampagne erinnern, die nicht die gewünschten Resultate erzielte. Sie sieht den damaligen Misserfolg als Beweis dafür, dass sie nicht gut genug ist und ist sich sicher, dass auch ihre Vorgesetzten und alle anderen bald merken, dass sie eigentlich eine Versagerin ist und nicht kompetent für ihren Job.
Gemeinsam mit vielen Menschen, die am Hochstapler-Syndrom leiden, zeigt auch Marie typische Kennzeichen. Neben ihrer Angst aufzufliegen, macht sie externe Faktoren (Glück, Zufall etc.) für ihren Erfolg verantwortlich, anstatt den Erfolg ihren Fähigkeiten und ihrer eigenen Leistung zuzuschreiben. Zusätzlich sieht sie ihren einmaligen Misserfolg als Beweis für ihre Unzulänglichkeit.
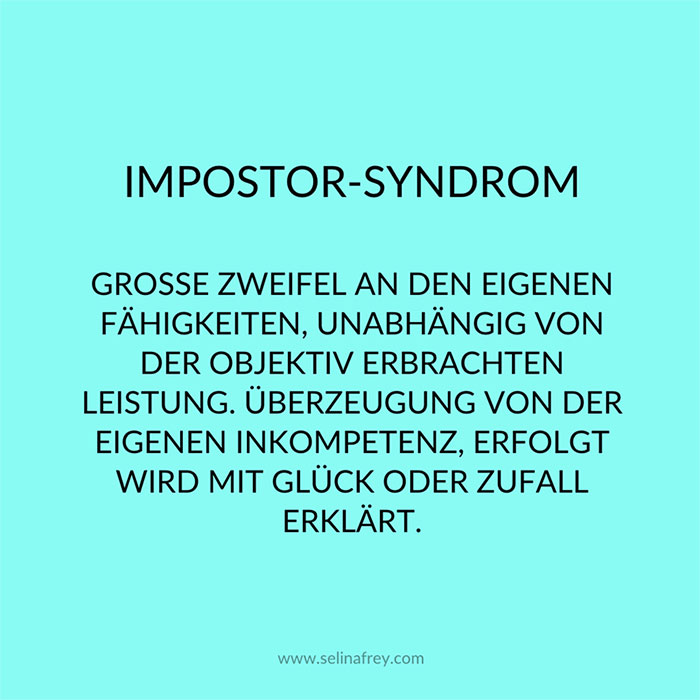
Persönlichkeitsmerkmal und keine psychische Erkrankung
1978 befassten sich die Psychologinnen Rose Clance und Suzanne Imes erstmals mit dem Phänomen. Neue Forschungsarbeiten zeigen, dass ca. 70% aller Menschen mindestens einmal im Leben unter diesen starken Gefühlen leiden.
Beim Impostor-Syndrom handelt es sich nicht um eine psychische Erkrankung, sondern es ist eine Reaktion auf bestimmte Gefühle und Situationen. Verschiedene Fachpersonen verwenden daher lieber Begriffe wie Selbstkonzept oder Phänomen und sehen es als eine Art Persönlichkeitsmerkmal, welches verschieden stark ausgeprägt sein kann.
Mögliche Ursachen
Es gibt nicht die eine Ursache, die dafür verantwortlich ist, wenn du irrationale Selbstzweifel und Versagensängste spürst. Neben genetischen Faktoren, deiner persönlichen Sozialisation, spielt auch die Umwelt, sprich unsere Leistungsgesellschaft eine Rolle.
Bei der Sozialisation geht es insbesondere darum, ob du in der Kindheit deinen Selbstwert gut ausbilden konntest (siehe Blogartikel Selbstwert). Wenn in der Kindheit die Grundbedürfnisse (siehe Blogartikel Grundbedürfnisse) nicht erfüllt wurden, ist es möglich, dass das Kind Strategien entwickelt, um über Leistung, Anpassung, Perfektionismus zur gewünschten Liebe und Anerkennung der Eltern zu gelangen. Ein widersprüchlicher Erziehungsstil bezüglich der Leistungsfähigkeit (Wechsel zwischen übermässigen Lob und heftiger Kritik) kann ein Kind verunsichern, so dass es nicht mehr weiss, ob es überhaupt etwas kann.
Hinzu kommen die Ansprüche der Gesellschaft und diese sind äusserst leistungsbezogen. Meist sucht man ausserdem vergebens eine gute Fehlerkultur und so erhöht sich die Angst vor Fehlern, Ablehnung und Kritik. In den sozialen Medien wird meist ein Idealbild präsentiert, welches zum Vergleich einlädt und die eigene Wahrnehmung noch weiter verzerrt.
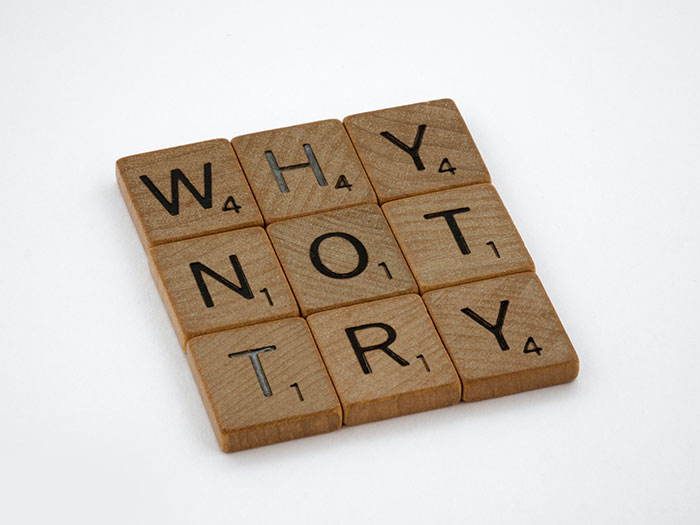
Von Perfektionistinnen und Prokrastination
Im Alltag sind meist Verhaltensweisen sichtbar, welche du aufgrund des Zweifels entwickelt hast.
Marie zeigt ein typisches Verhalten: sie arbeitet äusserst sorgfältig und gewissenhaft, bereitet alles bis ins letzte Detail vor und neigt zum Perfektionismus.
Daneben gibt es aber noch eine zweite Bewältigungsstrategie: die Prokrastination. Von „Aufschieberitis“ betroffene Personen haben ebenfalls Angst zu versagen und sich zu blamieren, aber diese Angst hemmt sie, mit der Arbeit überhaupt anzufangen. Dies führt dazu, dass sie entweder gar nicht beginnen, sich nicht anstrengen oder sie beginnen viel zu spät. Wenn diese Personen im Anschluss einen Misserfolg verbuchen müssen, welcher der Vorgehensweise verschuldet ist, deuten sie diesen jedoch als Bestätigung für ihre Unfähigkeit.
Wenn die vermeintliche Inkompetenz ins Burnout führt
Marie arbeitet unglaublich viel und scheut Überstunden und Nachtschichten nicht. Die Furcht, aufzufliegen führt zu Dauerstress. Sie leidet unter Schlafstörungen und des Öfteren kämpft sie mit Kopfschmerzen. Ausserdem beklagt sich ihr Umfeld, da sie oft keine Zeit hat und im letzten Moment Abmachungen absagt, weil sie noch länger im Büro bleibt.
Um Höchstleistungen zu vollbringen, gehen Menschen wie Marie oft über die eigenen Grenzen und gefährden langfristig ihre (psychische) Gesundheit. Dies zeigt sich in psychosomatischen Beschwerden wie Schlafstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen oder kann im Extremfall zu einem Burnout führen.
Neben ernstzunehmenden gesundheitlichen Risiken kann sich das Impostor-Phänomen noch weiter nachteilig auf die berufliche Laufbahn auswirken. Menschen wie Marie neigen dazu Herausforderungen und Beförderungen abzulehnen, sich Weiterbildungen nicht zuzutrauen und aufgrund der Furcht, dass ihre Unfähigkeit auffliegen könnte, kann es dazu kommen, dass eine Person die aktuelle Stelle kündigt.
Ausbruch aus dem Teufelskreis
Damit du nachhaltig aus diesem Teufelskreis aussteigen kannst, ist es wichtig, dass du ein realistisches Bild von dir selbst aufbaust. Dies bedeutet, dass du deine Fähigkeiten und deine Erfolge anerkennst und dir gleichzeitig eingestehst, dass du weder perfekt bist noch sein kannst. Ausgehend davon kannst du nicht förderliche Verhaltensweisen erkennen, verändern, realistische Anforderungen an dich stellen und deine Erfolge feiern.
Im Folgenden einige Inputs, die dich auf diesem Weg unterstützen können:
Reflexion:
Nimm dir Zeit, dich mit deinen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen. Wenn es dir schwerfällt deine Stärken und Schwächen zu benennen, frag Freunde, Familie und Kollegen.
Halt inne, wenn das Impostor-Phänomen auftritt: Welche Situationen lösen diese Gedanken aus? Welche Gefühle kommen auf? Falls du schwarz malst – wie wahrscheinlich ist es, dass dies eintritt? Hast du Beweise dafür und dagegen? Wie sieht das Best-case-Szenario aus?
Austausch:
Tausch dich mit Menschen aus, denen du vertraust. Wenn du deine Ängste teilst, verlieren sie oft an Kraft. Du wirst dabei merken, dass Leute, die du für kompetent hältst, selbst eine verzerrte Wahrnehmung von sich und ihren Fähigkeiten haben. Dies hilft dir auch, deine verzerrte Wahrnehmung zu entdecken.
Umgang mit Kritik und Misserfolg:
Wenn etwas nicht gelungen ist, sieh dies als Input an, wo du dich noch weiterentwickeln darfst. Hüte dich aber davor, dies als persönliche Niederlage zu sehen – du bist nicht deine Leistung.
Komplimente und Lob annehmen:
Lerne Lob für deine Leistungen anzunehmen. Ein „Danke, das freut mich“ reicht, rede dich danach nicht klein.
Erfolgstagebuch:
Notier dir abends alle Erfolge, Komplimente und positiven Feedbacks in einem Tagebuch. Schreib auch dazu, welche Fähigkeiten und Charaktereigenschaften dir geholfen haben, dies zu erreichen. So kannst du dich objektiver beurteilen und kannst du es in Momenten des Zweifelns zusätzlich als Nachschlagewerk hervorkramen.
Erwarte keine Veränderung von heute auf morgen, denn diese Selbstzweifel haben sich höchstwahrscheinlich über die Jahre verfestigt. Bei sehr starken Selbstzweifeln kann eine psychologische Beratung dich dabei unterstützen, den Leidensdruck zu lindern, sowie dir Strategien an die Hand geben, um mit dem Stress, welcher oft mit dem Hochstapler-Phänomen einhergeht, besser umzugehen.
In Aktion
Im letzten Abschnitt hast du bereits sehr viele Strategien an die Hand bekommen.
- Solltest du den Eindruck haben, vom Hochstapler-Phänomen betroffen zu sein:
Zu welcher Kategorie würdest du dich eher zählen:
Perfektionistin oder Aufschieberin - Welche dysfunktionale Verhaltensweise nutzt du, welche vom Impostor-Phänomen geprägt ist?
- Welche neue Strategie möchtest du ausprobieren?
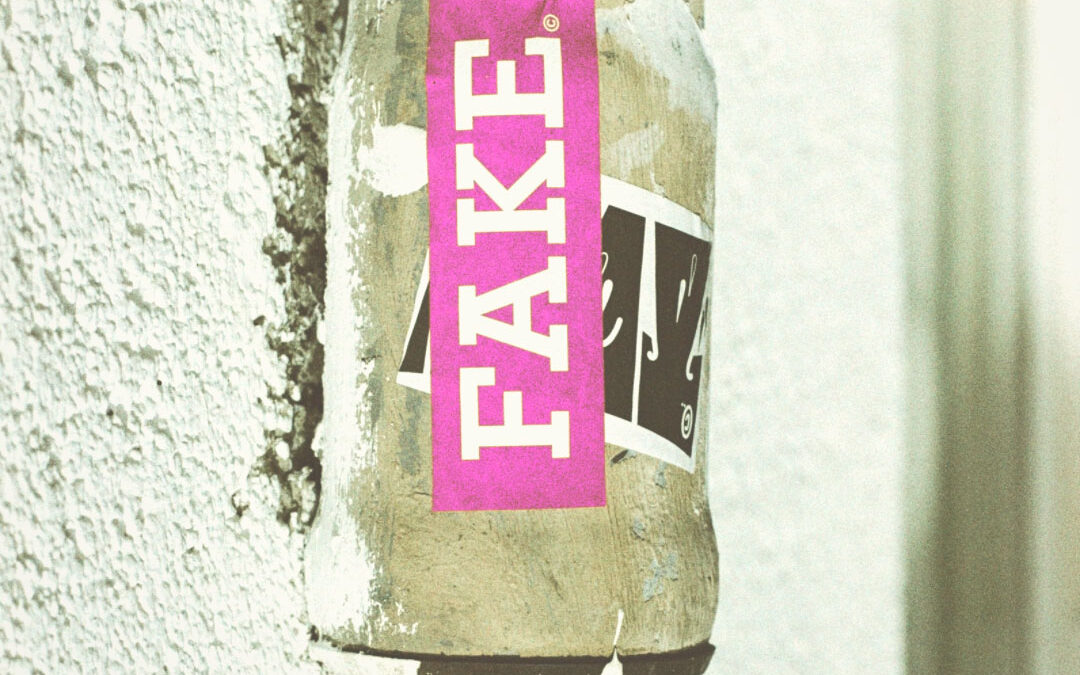
Trackbacks/Pingbacks